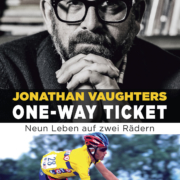One-Way Ticket
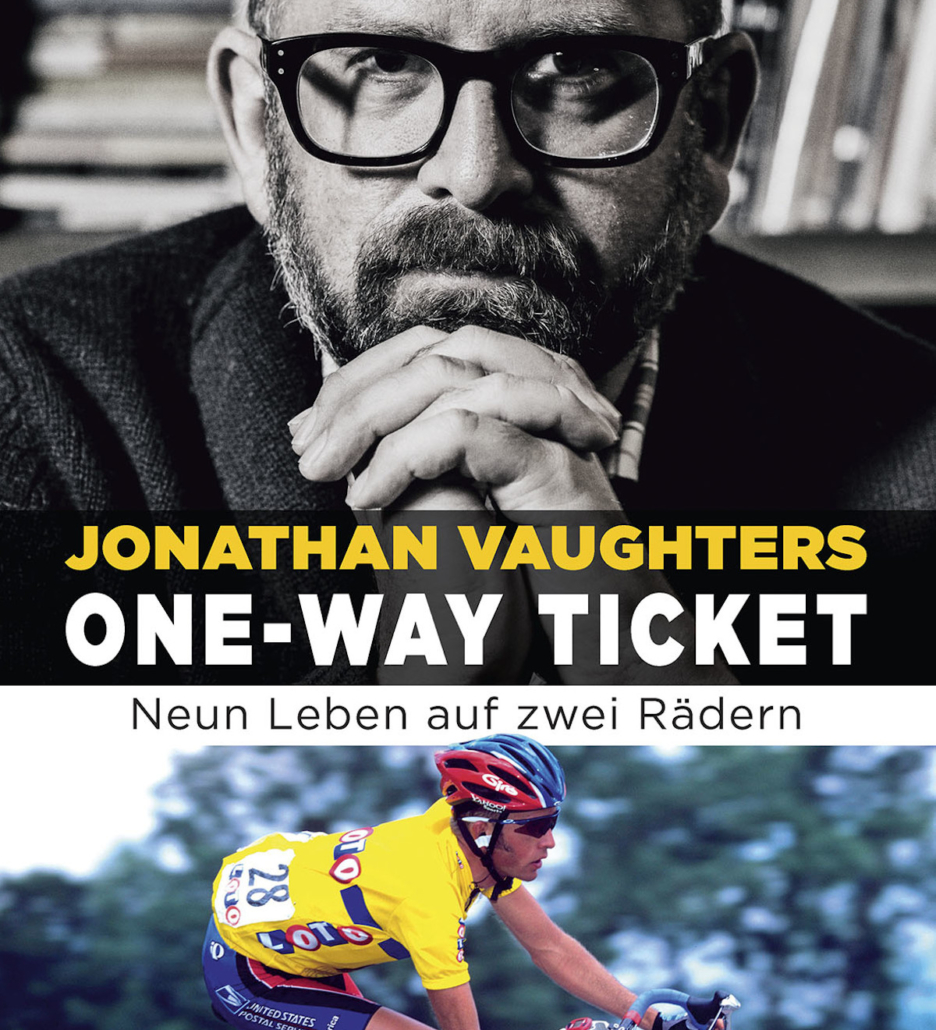
Corona legt den Radsport lahm. Aber es gibt ja noch die Bücher zum Thema. „One-Way-Ticket“ ist die Autobiografie des ehemaligen Profis und aktuellen Rennstall-Managers Jonathan Vaughters.
Jonathan Vaughters hat Asperger – wie Greta Thunberg. Diese Form des Autismus befähigt Menschen, sich voll und ganz auf eine Sache zu konzentrieren. Bei Thunberg ist es der Klimaschutz, bei Vaughters das Rennradfahren. Und hier vor allem: das Zeitfahren. Alleine gegen die Uhr, bis zur totalen Erschöpfung in die Pedale treten, die Schmerzen einfach ignorieren, – das konnte der US-Boy aus Colorado so gut wie kein anderer. Und das ist das erste, was man bei der Lektüre von „One Way Ticket“ (Covadonga) lernt: Eindimensionalität kann einen im Radsport weit bringen, soziale Kompetenz braucht man hingegen weniger.
Die Fähigkeit zu leiden und sich auf ein Ziel auszurichten, hat Jonathan Vaughters allerdings nicht vor Doping bewahrt. Als er Mitte der 90er-Jahre nach Europa ging, um Profi zu werden, fuhr Vaughters der Konkurrenz hoffnungslos hinterher – trotz Asperger und seiner außergewöhnlich großen Herzkammer. Also griff er selbst zur Spritze. Und der Autor lässt uns durchs Schlüsselloch gucken: Epo in Thermosflaschen, Teamärzte, die unterm Trenchcoat Stoff ins Hotel schmuggeln, Infusionsbeutel, die an der Zimmerwand kleben, – das volle Programm. Und mittendrin der Oberschurke: Lance Armstrong.
Zwei Jahre fuhr Vaughters für das US Postal Team und den Mephisto des Radsports. Aber Vaughters beschreibt Armstrong nicht nur als einen diabolischen Machtmenschen. Zu Beginn seiner Karriere sei Armstrong ein vehementer Dopinggegner gewesen. Die Seiten habe er gewechselt, weil sich Armstrong um seinen rechtmäßigen Erfolg gebracht sah.
Jonathan Vaughters hatte beim Dopen stets ein schlechtes Gewissen. Schreibt er in seiner beim Covadonga-Verlag erschienen Autobiografie („One-Way Ticket“). Und dass Gewissensbisse der Grund gewesen seien, warum er mit dem Radsport aufgehört hat. Endlich frei sein – und Schluss machen mit der Sucht. Losgekommen vom Radsport ist Vaughters nicht. Als Manager und Rennstall-Leiter spielte er schon bald wieder mit im Pedal- Zirkus. Wenn auch unter anderen Vorzeichen. Das von ihm gegründete Slipstream-Team trat an, sauber zu sein. Es galt eine strikte Antidoping-Linie; und Vaughters sagte als Kronzeuge gegen Lance Armstrong aus.
Möglicherweise überhöht Vaughters seine Rolle als Aufklärer und Erneuerer. Zwischen den Zeilen liest man: Gerne hätte er Armstrong höchstpersönlich zu Fall gebracht. Wohl auch, um im Kampf gegen die eigene Vergangenheit als Sieger hervorzugehen.
Dabei ist der Radsport auch ohne Doping ein Sport der Lügen. Gibt Vaughters freimütig zu. Dass er mit seinem Rennradstall schon des Öfteren vor der Pleite stand und dennoch Fahrer überredete, ihren Vertrag zu verlängern. Immerhin: Epo muss Jonathan Vaughters dafür nicht spritzen. Und offensichtlich lassen sich Vertragsgespräche auch mit Asperger erfolgreich führen.