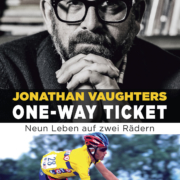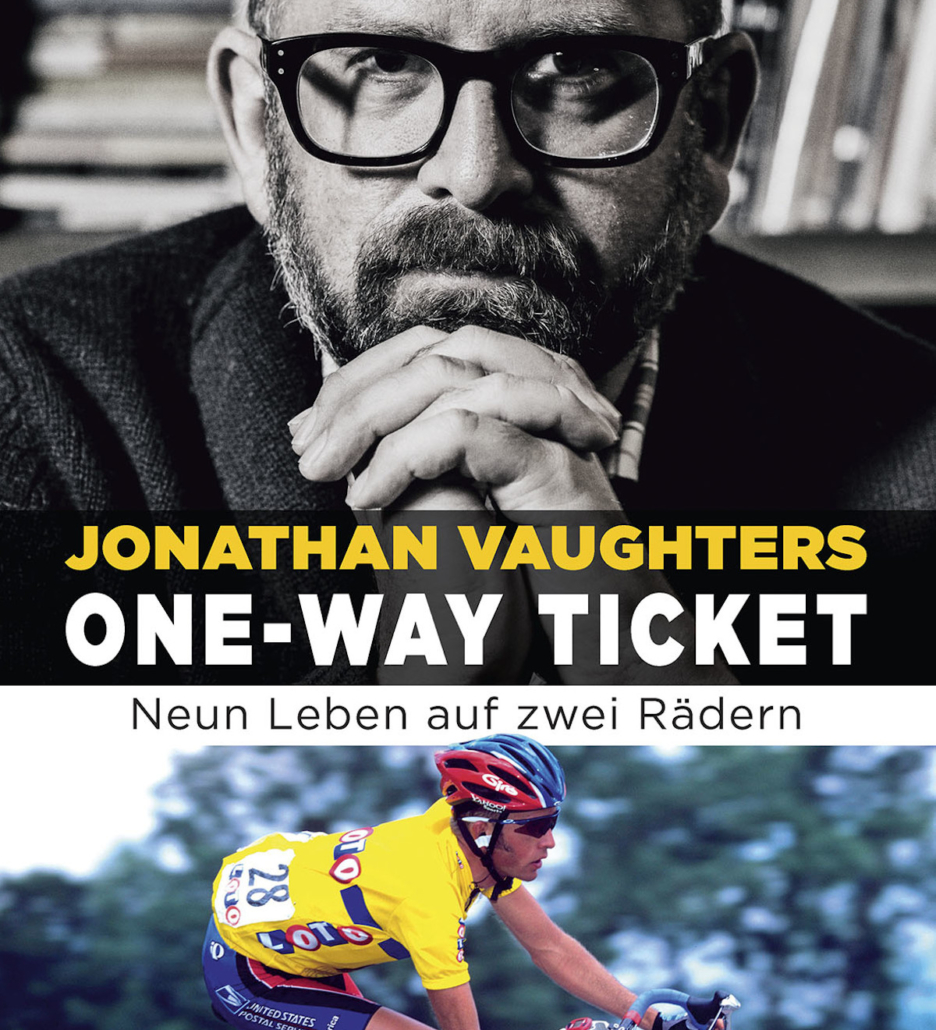Ein Auto auf zwei Rädern

Es gibt Leute, die stellen sich eine Hifi-Anlage für 11.000 Euro in die Bude und hören dann doch nur „Smoke on the Water“. Insofern könnte es moralisch auch vertretbar sein, auf einem sehr teuren Rennrad Trainingsrunden zu drehen, die man üblicherweise mit seinem alten Klepper dreht. Und 11.000 Euro kostet die BMC Teammaschine SLR 01 ja gar nicht. Sondern nur 10.999.
Ja, für das Geld bekommt man auch ein Auto. Wenn auch nur einen Dacia. Der hätte dann aber immerhin Klimaanlage, Tempomat, Einparkhilfe, beheizbare Außenspiegel sowie auf Wunsch die Sonderlackierung Kalahari-Rot. Ach ja, ein Ersatzrad wäre auch noch inklusive. Das fehlt bei der Teammaschine. Würde nochmal anderthalb Tausend extra kosten.
Und fällt das gute Stück um und auf die falsche Carbonstelle, ist es kaputt. Warum sollte man sich also etwas derart Hochpreisiges und Wertinstabiles kaufen? Gute Frage, dachte ich mir. Und bei BMC waren sie so nett, mir bei der Beantwortung zu helfen. Das Auto auf zwei Rädern kam in einem Pappkarton.
Mein erster Eindruck, ein klassisch-physikalischer: ziemlich leicht die Maschine. Trotz Scheibenbremsen und Pedalen. Denn ohne Pedale fährt es sich bekanntlich schlecht. Also habe ich die mitgewogen. Nicht ganz sieben Kilo, vielleicht 50 Gramm weniger. Das sind ein paar Scheiben Salalmi.
Ausgestattet mit den Berglaufrädern von DT Swiss fühle ich mich gut gerüstet für den Berliner Gipfelsturm. Und den Hügel hoch zum Grunewaldturm tritt es sich tatsächlich sehr leicht und locker. Dass ich schon dachte, da schiebt wer von hinten. Aber da war niemand. Ich habe mich umgeschaut.
Mein Garmin wollte trotzdem keinen Personal Record vermelden, obwohl ich mich selbst schon ganz leicht und locker fühlte. Sollte ich etwa Opfer einer luxuriösen Eigentäuschung geworden sein? Das macht der Mensch ja gerne mal, sich hinters Licht führen. Gerade wenn etwas exklusiv daherkommt.
Umso mehr stellt sich die Frage nach dem Sinn und der Vernunft. Wer braucht ein Fahrrad für 10.999 Euro, wenn man ein richtig gutes auch für die Hälfte bekommt, das nur 500 Gramm mehr wiegt? Was zugegeben recht viele Scheiben Salami sind. Aber lässt man eine Trinkflasche zuhause, fällt die Wurst nicht mehr ins Gewicht.
Auf der anderen Seite muss vielleicht nicht immer alles vernünftig und sinnvoll sein. Das Gefühl fährt schließlich auch mit. Und auf einer Teammaschine SLR 01 ist das ein gutes Gefühl. Nur sollte man bedenken, dass man mit einem derartigen Geschoss keine Entschuldigung mehr hat. Wenn der Typ mit dem Mountainbike an einem vorbeizieht, lässt sich das nicht auf das mangelhafte Material schieben. Das sollte man wissen: Der Druck wächst, man muss immer performen.
Außer man ist ein notorischer Angeber. Und leistet sich das Luxusgut eben darum: um luxuriös anzugeben. Solche Leute soll es ja auch geben, die das Rennrad passend zum Helm kaufen. Die haben dann aber eher keinen Dacia in der Garage stehen, nehme ich an.
Meine Nachbarin findet das Auto auf zwei Rädern im Übrigen „chic“. Und das stimmt. Die BMC-Maschine ist schön schlank, rhythmisch geschwungen und äußerst aufgeräumt, mit den beiden integrierten Flaschenhalten und so ohne jeden Zug. Denn die Bremsseile verschwinden im orange-roten Lenker-Cockpit. Und geschaltet wird per Funk und Red Etap. Was smoother ist als in einem Dacia.
Bei einem derart schicken Rad muss allerdings auch der Fahrer chic sein – und in shape. Andernfalls leidet das Gesamtbild, wenn das Geschoss von jemandem gelenkt wird, der selbst eher gewichtig dahin kugelt und gerne mal in die Gegend guckt.
Slow Motion in High End, das wäre dann doch ein übertrieben dekadenter Spaß, meine ich. Aber wo hört der Spaß auf und fängt der Snobismus an? Das muss wohl jeder für sich beantworten, der das will und vor allem kann: 10.999 Euro für ein Spielzeug ausgeben.
Mein Fazit des Luxus-Selbstversuches: Entscheidend ist noch immer die Maschine, die obendrauf sitzt. Aber technisch spricht nichts dagegen, wenn die Maschine untendrunter auch ein Auto sein könnte.